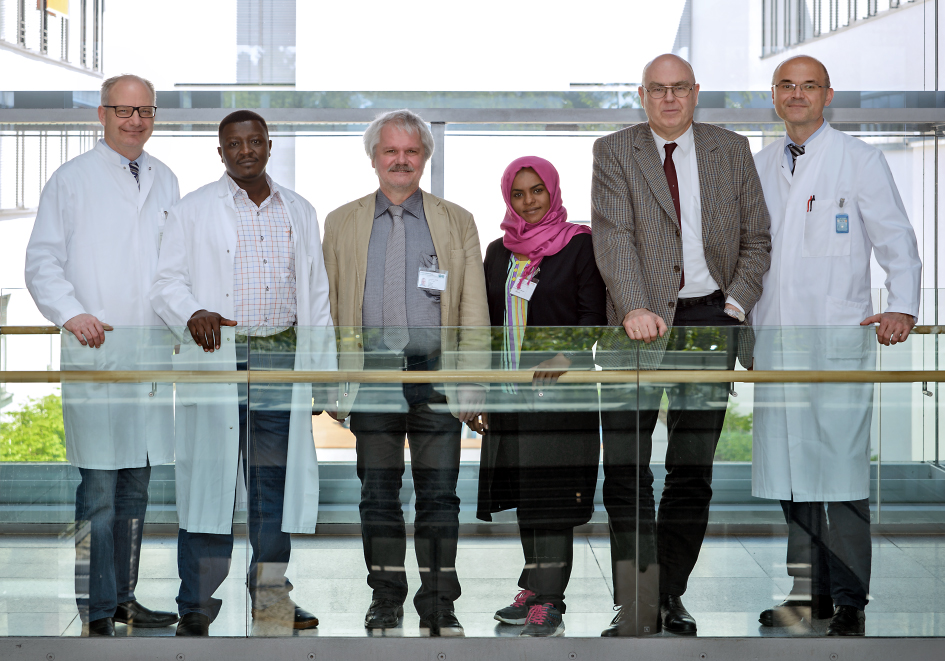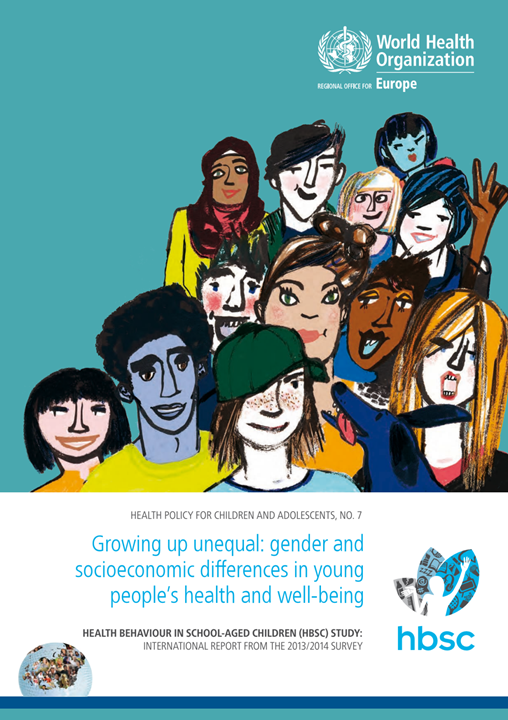Der Physiker Prof. Torsten Rahne und der Mediziner Dr. Ingmar Seiwerth sind bei der Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie jeweils mit dem 1. Platz des Broicher-Preises geehrt worden. Prof. Rahne erhielt den Preis in der Kategorie „Experimentelle Forschung“ für seine Arbeit „Dimensionen von Mastoiden und ihre Konsequenzen für die Geometrie transkutaner Knochenleitungsimplantate“. Dr. Seiwerth wurde in der Kategorie „Klinische Forschung“ für seine Arbeit zum Thema „Erfahrungen mit dem teilimplantierbaren Knochenleitungshörgerät Bonebridge: Computer-assistierte präoperative 3D-Planung und audiologische Ergebnisse bei Erwachsenen und Kindern“ ausgezeichnet.
Damit ging der erste Platz in beiden Kategorien an die hallesche Universitätsmedizin und zum ersten Mal überhaupt in seiner Geschichte an eine einzige Klinik. „Das ist schon sehr ungewöhnlich, deshalb freuen wir uns sehr darüber“, sagt Prof. Dr. Stefan Plontke, Direktor der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie am Universitätsklinikum Halle (Saale). Die beiden ersten Plätze des Broicher-Preises sind mit jeweils 1.000 Euro dotiert.
Die beiden Preisträger setzten sich bei der Preisvergabekommission gegenüber knapp 300 Mitbewerbern durch. Die geehrten Arbeiten sind aus einer intensiven Forschungskooperation zwischen der Universitäts-HNO-Klinik und PD Dr. Florian Radetzki vom Department für Orthopädie, Unfall- und Wiederherstellungschirurgie (DOUW) des halleschen Universitätsklinikums entstanden.
Der vom Kölner Arzt Franz-Joseph Broicher gestiftete Preis für die besten wissenschaftlichen Posterpräsentationen wird jährlich bei der Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie vergeben. Bewertet wird nicht allein die wissenschaftliche Arbeit, sondern vor allem auch, wie geschickt didaktische und graphische Mittel eingesetzt wurden, um den wissenschaftlichen Inhalt verständlich und eindrucksvoll zu vermitteln.